Mittwoch, 17. Dezember 2025
Zensur und Morddrohungen gegen Journalisten
jf.bremen, 16:05h
miniaturen berichtete im Vorjahr über die zunehmenden Zensur-Anstrengungen der rechtsextremen Regierung in Israel: „Israel sperrt Archive“ für die freie wissenschaftliche Forschung (23.03.2024) und „Medienzensur in Israel“. Ein neues Gesetz regelt, dass die Regierung ausländische Sender verbieten kann, wenn die „nationale Sicherheit“ gefährdet ist. Erstes Opfer war der liberale arabischsprachige TV-Sender Al-Jazeera.
Jetzt wird die Zensur fortgesetzt, unterstützt von öffentlichen Drohungen gegen Medienschaffende. Der israelische Journalist Guy Peleg wurde nach einem Vortrag in Tel Aviv auf der Straße von mehreren Männern bedrängt und bedroht. Als er wegfahren will, blockieren sie sein Auto. „Guy Peleg, egal wo auf der Welt du hingehst, du wirst eine Polizeieskorte brauchen“, ruft einer von ihnen.
Peleg wird seit Langem angefeindet, nicht zuletzt, weil er über den Korruptionsprozess gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu berichtet hat. Er wird explizit mit Mord bedroht, u.a. auch die Familie.
Im Mai rutschte Israel im World Press Freedom Index von Reporter ohne Grenzen auf Platz 112 von 180 – die niedrigste Platzierung des Landes, seit der Index 2002 begonnen hat.
Das so entstehende Klima von Einschüchterung und Angst führt zu immer mehr Selbstzensur.
Jetzt wird die Zensur fortgesetzt, unterstützt von öffentlichen Drohungen gegen Medienschaffende. Der israelische Journalist Guy Peleg wurde nach einem Vortrag in Tel Aviv auf der Straße von mehreren Männern bedrängt und bedroht. Als er wegfahren will, blockieren sie sein Auto. „Guy Peleg, egal wo auf der Welt du hingehst, du wirst eine Polizeieskorte brauchen“, ruft einer von ihnen.
Peleg wird seit Langem angefeindet, nicht zuletzt, weil er über den Korruptionsprozess gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu berichtet hat. Er wird explizit mit Mord bedroht, u.a. auch die Familie.
Im Mai rutschte Israel im World Press Freedom Index von Reporter ohne Grenzen auf Platz 112 von 180 – die niedrigste Platzierung des Landes, seit der Index 2002 begonnen hat.
Das so entstehende Klima von Einschüchterung und Angst führt zu immer mehr Selbstzensur.
... link (0 Kommentare) ... comment
Atemlos
jf.bremen, 15:43h
Die Schlagersängerin Helene Fischer ("Atemlos durch die Nacht") erklärte, sie werde in der Öffentlichkeit meist nicht erkannt. Macht sie das so atemlos?
Wen wundert's? Wer erkennt eine Frau mit einem derart ausdruckslosen Dutzendgesicht, wenn sie nicht ihren Glitter-Fummel anhat?
Wen wundert's? Wer erkennt eine Frau mit einem derart ausdruckslosen Dutzendgesicht, wenn sie nicht ihren Glitter-Fummel anhat?
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 3. Dezember 2025
Rechte Medien gegen ARD-Korrespondentin
jf.bremen, 14:36h
Die ARD-Korrespondentin in Israel, Sophie von der Tann, soll den Hanns-Joachim-Friedrich-Preis erhalten. Diese Auszeichnung wird für besondere journalistische Leistungen im Fernsehen verliehen. Von der Tann zeichnet sich durch sorgfältige Recherche, ausgewogene Berichterstattung, klare Sprache, Hintergrundwissen und Wagemut aus: sie hat unter äußerst schwierigen Bedingungen während des Gasa-Kriegs in Gasa recherchiert.
Unisono kritisieren die „FAZ“, die „Jüdische Allgemeine“, „Welt“ und der Pressesprecher der israelischen Armee die Entscheidung. Der Armeesprecher spricht vom „neudeutschen Juden- und Israelhass“. Der Vorwurf: Sie habe in einem Hintergrundgespräch – also nicht im Fernsehen! – darauf hingewiesen, der 7. Oktober habe eine „Vorgeschichte“. Aus Hintergrundgesprächen wörtlich zu zitieren, verstößt gegen journalistische Regeln. Das trifft nicht von der Tann, sondern die „Welt“, die ja nun nicht gerade für journalistische Tugenden geradesteht. Gewünscht wird Gesinnungsjournalismus, was das Gegenteil von seriöser Berichterstattung ist.
Natürlich hat das Datum eine Vorgeschichte, wie jedes andere Datum auch. Von der Tanns Bemerkung ist weder neu noch originell, jedenfalls ist sie durchaus zutreffend.
miniaturen hat seinerzeit darauf hingewiesen (21.10.2023 „Ein zweiter Yom-Kippur-Krieg“), ebenso wie der renommierte Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Mosche Zimmermann: „Seit über zehn Jahren verweigert die Rechtsregierung Gespräche mit den Palästinensern. Sie fördert stattdessen massiv die Siedlerbewegung im Westjordanland.“ Zimmermann Juden- und Israelhass vorwerfen zu wollen, wäre einigermaßen absurd.
Der Angriff konservativer Medien auf die ARD-Korrespondentin ist Teil einer Kampagne gegen das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen (ÖRF), die – mal wieder – angeführt wird von der AfD. Es muss klar sein, dass das ÖRF europaweit anerkannt und unbedingt erhaltenswert ist. Internationale Radio- und Fernsehmacher beneiden Deutschland darum! Das soll auch so bleiben.
Unisono kritisieren die „FAZ“, die „Jüdische Allgemeine“, „Welt“ und der Pressesprecher der israelischen Armee die Entscheidung. Der Armeesprecher spricht vom „neudeutschen Juden- und Israelhass“. Der Vorwurf: Sie habe in einem Hintergrundgespräch – also nicht im Fernsehen! – darauf hingewiesen, der 7. Oktober habe eine „Vorgeschichte“. Aus Hintergrundgesprächen wörtlich zu zitieren, verstößt gegen journalistische Regeln. Das trifft nicht von der Tann, sondern die „Welt“, die ja nun nicht gerade für journalistische Tugenden geradesteht. Gewünscht wird Gesinnungsjournalismus, was das Gegenteil von seriöser Berichterstattung ist.
Natürlich hat das Datum eine Vorgeschichte, wie jedes andere Datum auch. Von der Tanns Bemerkung ist weder neu noch originell, jedenfalls ist sie durchaus zutreffend.
miniaturen hat seinerzeit darauf hingewiesen (21.10.2023 „Ein zweiter Yom-Kippur-Krieg“), ebenso wie der renommierte Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Mosche Zimmermann: „Seit über zehn Jahren verweigert die Rechtsregierung Gespräche mit den Palästinensern. Sie fördert stattdessen massiv die Siedlerbewegung im Westjordanland.“ Zimmermann Juden- und Israelhass vorwerfen zu wollen, wäre einigermaßen absurd.
Der Angriff konservativer Medien auf die ARD-Korrespondentin ist Teil einer Kampagne gegen das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen (ÖRF), die – mal wieder – angeführt wird von der AfD. Es muss klar sein, dass das ÖRF europaweit anerkannt und unbedingt erhaltenswert ist. Internationale Radio- und Fernsehmacher beneiden Deutschland darum! Das soll auch so bleiben.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 1. November 2025
Rausschmiss nach Fastnachts-Rede
jf.bremen, 13:11h
„Der Hofnarr gehört“ – laut Wikipedia – „zum ständigen (und bezahlten) Personal, mit dem der Fürst sich umgibt, und er hat die Aufgabe, das Verhalten des Fürsten teils öffentlich, teils vertraulich zu kommentieren und ihm einen kritischen Spiegel vorzuhalten.“
Der Narr durfte – und sollte! – dem Fürsten, gern auch in komischer, satirischer Form, Wahrheiten und Korrektive vorhalten, was den übrigen Höflingen, schon gar dem gemeinen Volk, streng verboten war. Der Narr hatte eine eigene Freiheit und durfte wegen seiner Äußerungen nicht bestraft werden.
Zur besseren Kenntlichkeit trug er eine Narrentracht, meist gelbe und grüne Hose, Wams und Kappe. Letztere war mit kleinen Glocken besetzt. So war der Narr als solcher optisch und akustisch kenntlich. Bis heute gibt es in ritualisierter Form Narren und Bühnen für ihren Spott. Da sind in erster Linie der Karneval und die Fastnacht zu nennen.
In Bayern wird traditionell zur Fastnacht am Nockherberg ein Starkbierfest begangen. Hauptattraktion ist das Politiker-Derblecken. Ein oder mehrere Redner halten eine Rede, in der sie sich auf humorvolle Weise kritisch mit aktuellen Ereignissen auseinandersetzen. Ein ebenfalls satirisches Singspiel und ein musikalisches Rahmenprogramm gehören dazu.
In den Vorjahren hielt der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth die Rede. In scharfer Form kritisierte er – nicht nur – den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Dieser machte, wie früher schon keine gute Miene zum Spiel. 2025 war nunmehr das letzte Mal. Nach scharfer Kritik aus der CSU beschloss der Veranstalter, die Paulaner-Brauerei, Maxi Schafroth im nächsten Jahr nicht wieder einzuladen. Schafroth sprach im Interview der SZ von einem Rauswurf.
Da haben wir es: die jahrhundertealte Narrenfreiheit, d.h. die Immunität des Hofnarren gegen Bestrafung, galt vom Feudalismus bis zum letzten Jahr. In Bayern hält man Kritik, vor allem scharfe Kritik, nicht aus. Da muss gestraft werden. Mit Kündigung.
Was die humorlosen Bayern mal wieder nicht berücksichtigt haben: So ein Rauswurf steigert das öffentliche Interesse an dem Rausgeworfenen. Schafroth ist weiter gut beschäftigt, u.a. bei extra3 im Norddeutsche (!) Rundfunk. Blamiert sind die Paulaner-Brauerei, die Staatsregierung und die CSU.
Der Narr durfte – und sollte! – dem Fürsten, gern auch in komischer, satirischer Form, Wahrheiten und Korrektive vorhalten, was den übrigen Höflingen, schon gar dem gemeinen Volk, streng verboten war. Der Narr hatte eine eigene Freiheit und durfte wegen seiner Äußerungen nicht bestraft werden.
Zur besseren Kenntlichkeit trug er eine Narrentracht, meist gelbe und grüne Hose, Wams und Kappe. Letztere war mit kleinen Glocken besetzt. So war der Narr als solcher optisch und akustisch kenntlich. Bis heute gibt es in ritualisierter Form Narren und Bühnen für ihren Spott. Da sind in erster Linie der Karneval und die Fastnacht zu nennen.
In Bayern wird traditionell zur Fastnacht am Nockherberg ein Starkbierfest begangen. Hauptattraktion ist das Politiker-Derblecken. Ein oder mehrere Redner halten eine Rede, in der sie sich auf humorvolle Weise kritisch mit aktuellen Ereignissen auseinandersetzen. Ein ebenfalls satirisches Singspiel und ein musikalisches Rahmenprogramm gehören dazu.
In den Vorjahren hielt der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth die Rede. In scharfer Form kritisierte er – nicht nur – den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Dieser machte, wie früher schon keine gute Miene zum Spiel. 2025 war nunmehr das letzte Mal. Nach scharfer Kritik aus der CSU beschloss der Veranstalter, die Paulaner-Brauerei, Maxi Schafroth im nächsten Jahr nicht wieder einzuladen. Schafroth sprach im Interview der SZ von einem Rauswurf.
Da haben wir es: die jahrhundertealte Narrenfreiheit, d.h. die Immunität des Hofnarren gegen Bestrafung, galt vom Feudalismus bis zum letzten Jahr. In Bayern hält man Kritik, vor allem scharfe Kritik, nicht aus. Da muss gestraft werden. Mit Kündigung.
Was die humorlosen Bayern mal wieder nicht berücksichtigt haben: So ein Rauswurf steigert das öffentliche Interesse an dem Rausgeworfenen. Schafroth ist weiter gut beschäftigt, u.a. bei extra3 im Norddeutsche (!) Rundfunk. Blamiert sind die Paulaner-Brauerei, die Staatsregierung und die CSU.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 6. Oktober 2025
Zensoren sind blind (2)
jf.bremen, 17:31h
„Warum hält sich die Darstellung Max Beckmanns als ein von den Nazis verfolgter
Künstler dennoch so hartnäckig? Wissenschaftliche und publizistische Arbeiten zu Beckmann entstammen überwiegend der Feder von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern. Sie konzentrieren sich auf das Werk. Der biografische Rahmen ist dabei eher Nebenschauplatz, häufig aus Darstellungen übernommen, die entweder direkt von Familienmitgliedern, Freunden und Bewunderern Beckmanns verfasst worden waren oder aber ihrerseits auf diese zurückgriffen. Eine überzeugende Biografie des Jahrhundertkünstlers steht bis heute aus.“
Das schreibt Florian Keisinger in taz vom 6. Oktober 2025, S. 15, „Subtile Symbolik war nicht Sache der Nazis“
Es gibt Ausnahmen zu der von Florian Keisinger festgestellten Problematik. Ein Beispiel ist die rororo-Bildmonografie von Gertrud Fiege: Caspar David Friedrich, rororo als e-book, Caspar David Friedrich - Gertrud Fiege | Rowohlt Verlag, oder im Versandhandel u.a. bei jpc, oder Hugendubel. Als Taschenbuch im Versandhandel bei bücher.de, zvab.de u.a.
Das Bändchen geht ausführlich auf den biografischen und sozial-politischen Hintergrund von Friedrich und die Beziehungen zu seinen Werken ein; ist sehr empfehlenswert. Nicht verständlich ist, dass Rowohlt gerade im Friedrich-Jahr 2024 das Buch nicht wieder aufgelegt hat und nur noch als Hörbuch ohne Bilder anbietet.
Übrigens beschränkten sich nicht nur die Nazi auf das gesprochene Wort, sondern ebenso die Stasi und die syrische Diktatur Assads. Siehe dazu:
miniaturen.blogger.de von Jürgen Fiege, Beitrag vom 13.06.2028: „Zensoren sind blind“
Künstler dennoch so hartnäckig? Wissenschaftliche und publizistische Arbeiten zu Beckmann entstammen überwiegend der Feder von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern. Sie konzentrieren sich auf das Werk. Der biografische Rahmen ist dabei eher Nebenschauplatz, häufig aus Darstellungen übernommen, die entweder direkt von Familienmitgliedern, Freunden und Bewunderern Beckmanns verfasst worden waren oder aber ihrerseits auf diese zurückgriffen. Eine überzeugende Biografie des Jahrhundertkünstlers steht bis heute aus.“
Das schreibt Florian Keisinger in taz vom 6. Oktober 2025, S. 15, „Subtile Symbolik war nicht Sache der Nazis“
Es gibt Ausnahmen zu der von Florian Keisinger festgestellten Problematik. Ein Beispiel ist die rororo-Bildmonografie von Gertrud Fiege: Caspar David Friedrich, rororo als e-book, Caspar David Friedrich - Gertrud Fiege | Rowohlt Verlag, oder im Versandhandel u.a. bei jpc, oder Hugendubel. Als Taschenbuch im Versandhandel bei bücher.de, zvab.de u.a.
Das Bändchen geht ausführlich auf den biografischen und sozial-politischen Hintergrund von Friedrich und die Beziehungen zu seinen Werken ein; ist sehr empfehlenswert. Nicht verständlich ist, dass Rowohlt gerade im Friedrich-Jahr 2024 das Buch nicht wieder aufgelegt hat und nur noch als Hörbuch ohne Bilder anbietet.
Übrigens beschränkten sich nicht nur die Nazi auf das gesprochene Wort, sondern ebenso die Stasi und die syrische Diktatur Assads. Siehe dazu:
miniaturen.blogger.de von Jürgen Fiege, Beitrag vom 13.06.2028: „Zensoren sind blind“
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 30. September 2025
Besuch beim großen Bruder
jf.bremen, 12:04h
Schon lange angekündigt fand die Audienz von Netanyahu bei Präsident Trump gestern statt. Der Präsident begrüßte den Israeli vor der Haustür. Dann wandten beide sich der wartenden Presse zu. Netanyahu winkte verlegen grinsend mit der Hand, Trump präsentierte wie üblich den Daumen. Den sah Netanyahu und machte es dem großen Vorbild nach. Dann guckte er: Na, wie hab ich das gemacht? Vor Verlegenheit - wo bleib ich bloß mit den Händen? – hängte er den Daumen in die Hosentasche. Ganz reinstecken ging ja wohl nicht. Wieder der verlegene Blick zu Trump. Dann verschwanden die beiden im Haus.

Bubi wird von Papa gelobt.
Wenig später muss der Papa dem Bubi wohl den Kopf wegen der Bombardierung Katars gewaschen haben: Netanyahu rief in Katar an und entschuldigte sich für den Angriff!

Bubi wird von Papa gelobt.
Wenig später muss der Papa dem Bubi wohl den Kopf wegen der Bombardierung Katars gewaschen haben: Netanyahu rief in Katar an und entschuldigte sich für den Angriff!
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 8. September 2025
Unbewiesener Antisemitismus
jf.bremen, 18:07h
Jetzt wird die Antisemitismus-Keule wieder geschwungen. Die kommt immer dann zur Anwendung, wenn unliebsame Positionen zum Nahost-Krieg oder zu Israel geäußert werden. Antisemitismus ist ein Totschlag-Argument, gegen das man sich nur schwer wehren kann.
Ein unschönes Beispiel ist die Aberkennung des Donnepp Media Awards an Judith Scheytt, den diese von der Jury des Stiftervereins Freunde des Adolf-Grimme-Vereins verliehen bekommen hat. Ein nicht näher benannter „christlicher Verein“ protestierte und warf Scheytt nicht substantiierten Antisemitismus vor. Schon zog der Vorstand des Stiftervereins den Preis zurück. Fragwürdig sind die „Argumente“ gegen Scheytt: Sie habe zwar keine „explizit judenfeindlichen Äußerungen“ vertreten, folge aber „subtilen antisemitischen Mustern“. Ihre Berichte enthielten „Auslassungen, ungleiche Maßstäbe und verzerrte Darstellungen“. Alles keine gerichtsfesten Tatsachen, sondern Unterstellungen, Gerüchte, abstrakte Vorwürfe, garniert mit unbewiesenen Angaben des israelischen Militärs.
Der Vorwurf Verdrehung von Fakten und unbelegte Bewertungen geht an Vorstand der „Freunde“. Wenn das die Basis der Diskussion werden soll, dann können Kritik über den und Beurteilung des Gasa-Kriegs überhaupt nicht mehr geäußert werden. Frei nach Brecht könnte man der Jury empfehlen, sich einen neuen Vorstand zu wählen.
Ein unschönes Beispiel ist die Aberkennung des Donnepp Media Awards an Judith Scheytt, den diese von der Jury des Stiftervereins Freunde des Adolf-Grimme-Vereins verliehen bekommen hat. Ein nicht näher benannter „christlicher Verein“ protestierte und warf Scheytt nicht substantiierten Antisemitismus vor. Schon zog der Vorstand des Stiftervereins den Preis zurück. Fragwürdig sind die „Argumente“ gegen Scheytt: Sie habe zwar keine „explizit judenfeindlichen Äußerungen“ vertreten, folge aber „subtilen antisemitischen Mustern“. Ihre Berichte enthielten „Auslassungen, ungleiche Maßstäbe und verzerrte Darstellungen“. Alles keine gerichtsfesten Tatsachen, sondern Unterstellungen, Gerüchte, abstrakte Vorwürfe, garniert mit unbewiesenen Angaben des israelischen Militärs.
Der Vorwurf Verdrehung von Fakten und unbelegte Bewertungen geht an Vorstand der „Freunde“. Wenn das die Basis der Diskussion werden soll, dann können Kritik über den und Beurteilung des Gasa-Kriegs überhaupt nicht mehr geäußert werden. Frei nach Brecht könnte man der Jury empfehlen, sich einen neuen Vorstand zu wählen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 26. August 2025
Sarkasmus angemessen?
jf.bremen, 21:38h
Angesichts des Gasa-Kriegs bedarf der Begriff „Kollateralschaden“ einer neuen Definition. Die Treffsicherheit der israelischen Armee (IDF) lässt offensichtlich sehr zu wünschen übrig. Laut der Armeeführung sollte an dem Nasser-Krankenhaus eine Kamera ausgeschaltet werden, mit der Hamas Truppenbewegungen der IDF beobachtet habe.
Die „Begründungen“ werden immer unglaubwürdiger – wenn das überhaupt noch geht, In dem Fall wurden zwanzig Menschen, darunter fünf Presseleute, getötete. Das ist kein Kollateralschaden mehr. Das sind gezielte Tötungen und Kriegsverbrechen. Die ReporterInnen waren nach dem Schuss zum Krankenhaus geeilt, was ihre Aufgabe war, und wurden von einem zweiten aus derselben Panzerkanone vermutlich vom selben Schützen geschossenen Projektil getroffen.
Die Presseleute waren z.T. für westliche Medien (ap und Reuters) in Gasa. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb westliche Regierungen, sogar der US-Präsident, aus ihrer Duldungsstarre erwachten und wirklich in unerwarteter Härte gegen die Netanyahu-Regierung protestierten, Härte, die sie bisher bei hunderttausenden von Zivilisten nicht für nötig hielten.
Oder ist das Fass jetzt für sie voll?
Dabei ist das schon lange der Fall!
Die „Begründungen“ werden immer unglaubwürdiger – wenn das überhaupt noch geht, In dem Fall wurden zwanzig Menschen, darunter fünf Presseleute, getötete. Das ist kein Kollateralschaden mehr. Das sind gezielte Tötungen und Kriegsverbrechen. Die ReporterInnen waren nach dem Schuss zum Krankenhaus geeilt, was ihre Aufgabe war, und wurden von einem zweiten aus derselben Panzerkanone vermutlich vom selben Schützen geschossenen Projektil getroffen.
Die Presseleute waren z.T. für westliche Medien (ap und Reuters) in Gasa. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb westliche Regierungen, sogar der US-Präsident, aus ihrer Duldungsstarre erwachten und wirklich in unerwarteter Härte gegen die Netanyahu-Regierung protestierten, Härte, die sie bisher bei hunderttausenden von Zivilisten nicht für nötig hielten.
Oder ist das Fass jetzt für sie voll?
Dabei ist das schon lange der Fall!
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 23. Juli 2025
Unsinnige Überschrift
jf.bremen, 17:38h
„Synthetische Opioide verbreiten sich“, titelte der Weser-Kurier auf der ersten Seite der Ausgabe vom 16. Juli 2025. Das ist die wohl unsinnigste Überschrift im laufenden Kalenderjahr. Sie suggeriert, die Opioiden hätten quasi einen eigenen Willen, ein Eigenleben. Sie verschleiert die Tatsache, dass interessierte Menschen, nämlich Produzenten und Verkäufer von Drogen, und zwar der schlimmsten, das Gift bewusst und mit der klaren Absicht, exorbitante Gewinne mit ihm zu erzielen!
Diesen Text schicke ich als Leserbrief an den Weser-Kurier. Er wurde bisher nicht veröffentlicht.
Diesen Text schicke ich als Leserbrief an den Weser-Kurier. Er wurde bisher nicht veröffentlicht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 7. Mai 2025
Die Dauer des Augenblicks - Ein fotopädagogisches Handbuch -
jf.bremen, 17:28h
Beim Kopäd-Verlag vergriffen, verfügbar sind eventuell nur noch Mängelexemplare. Bei Amazon wird ein einziges gebrauchtes Exemplar für 49 € angeboten. Bei Ebay gibt es das Buch für 26,41€
Nun ist das Buch als CD in VÖLLIG NEUER BEARBEITUNG und aktualisiert verfügbar. Preis 10 € inklusive Porto und Verpackung.
BEZUG per E-Mail jürgen.fiege@nord-com.net.
...............................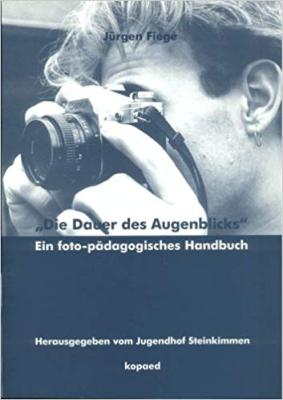
Im Internet wird das Buch von Praktikern sehr gelobt: Kommentare auf https://www.oly-forum.com:
"Echt Klasse" - "Super" - "Sehr interessante Literatur" -"Mal wieder ein Lesestoff fürs Wochenende" - "Nach dem Lesen auch von mir ein Dankeschön" -"Interessante Lektüre"
... und auf https://digitalfotograf.com: "habe einen interessanten Lesestoff zum Thema Bildgestaltung, Bildsprache, Komposition gefunden."
"...ich fand das Thema sehr gut zusammengefasst, so dass doch das eine oder andere wieder aus dem Hinterstübchen hervorgekramt wurde. Insofern lohnt sich, immer wieder einmal nachzuschlagen."
Nun ist das Buch als CD in VÖLLIG NEUER BEARBEITUNG und aktualisiert verfügbar. Preis 10 € inklusive Porto und Verpackung.
BEZUG per E-Mail jürgen.fiege@nord-com.net.
...............................
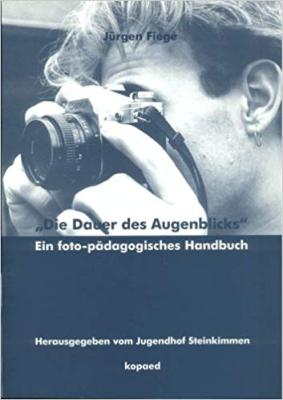
Im Internet wird das Buch von Praktikern sehr gelobt: Kommentare auf https://www.oly-forum.com:
"Echt Klasse" - "Super" - "Sehr interessante Literatur" -"Mal wieder ein Lesestoff fürs Wochenende" - "Nach dem Lesen auch von mir ein Dankeschön" -"Interessante Lektüre"
... und auf https://digitalfotograf.com: "habe einen interessanten Lesestoff zum Thema Bildgestaltung, Bildsprache, Komposition gefunden."
"...ich fand das Thema sehr gut zusammengefasst, so dass doch das eine oder andere wieder aus dem Hinterstübchen hervorgekramt wurde. Insofern lohnt sich, immer wieder einmal nachzuschlagen."
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite