Donnerstag, 10. November 2022
Ist Kritik an israelischem Regierungshandeln antisemitisch?
jf.bremen, 14:53h
Ein Buch wirbelt ideologischen Staub auf: Charlotte Wiedemann, "Den Schmerz der anderen begreifen". Es diskutiert in Essays und Reportagen die Frage, "wie eine deutsche Erinnerungskultur den Holocaust im Zentrum behalten kann, sich aber gleichzeitig entwickeln und für die Erinnerung an anderen Menschheitsverbrechen öffnen kann". (taz 10.11.22) Explizit wird dabei auch das Genozid, das deutsche Kolonialtruppen im heutigen Namibia anrichteten, beschrieben.
Auch die Vertreibung und die Massaker an palästinensischen Arabern behandelt das Buch. Voraussehbar kommt Kritik, ja der Vorwurf des Antisemitismus auf. "miniaturen" hat über die Problematik bereits früher geschrieben. Aus aktuellem Anlass geben wir zwei der Beiträge noch einmal wieder.
Auch die Vertreibung und die Massaker an palästinensischen Arabern behandelt das Buch. Voraussehbar kommt Kritik, ja der Vorwurf des Antisemitismus auf. "miniaturen" hat über die Problematik bereits früher geschrieben. Aus aktuellem Anlass geben wir zwei der Beiträge noch einmal wieder.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 26. Oktober 2022
Neue Hoffnung nach den Katastrophen
jf.bremen, 14:33h
Als die britischen Besatzer 1945 in das völlig zerstörte Hamburg einmarschierten, setzten sie als erstes eine Brauerei in Betrieb, sorgten dafür, dass die Straßenbahnen wieder fuhren und zwar mit neuen Fensterscheiben. Das Signal dieser zunächst verblüffenden Aktivitäten hieß: Es geht wieder aufwärts. Die Straßenbahnen fuhren in alle Stadtteile und trugen die frohe Botschaft überall hin. Und Bier gab's wieder und hob die Stimmung.
Als Hans Koschnik, Ex-Bürgermeister in Bremen, nach dem Balkan-Krieg EU-Administrator in Mostar für Bosnien-Herzegowina war, war er verantwortlich für den Wideraufbau. Koschnik hatte am Ende des Kriegs in Hamburg gelebt, und erinnerte sich an die verglasten Straßenbahnen. Nun gibt es in Mostar keine Straßenbahn, aber eine im Krieg zerstörte Brücke über den Fluss Neretva, das Wahrzeichen der Stadt. Die Brücke verbindet den bosnischen mit dem herzegowinischen Stadtteil. Koschnik sorgte als erstes dafür, dass dieses Wahrzeichen rekonstruiert wurde, als Symbol für den Wiederaufbau und die Verbindung der beiden Volksteile. Übrigens Mostar heißt Brücke.
-----------------------
Ähnliche Überlegungen werden jetzt für die Ukraine angestellt. Bereits jetzt während der russischen Bombardements auf die ukrainische Infrastruktur, sollen möglichst viele zerstörte Straßen, Brücken, Kraft- und Wasserwerke, Bahnhöfe und Gleisanlagen funktionsfähig gemacht werden. Das hat praktischen Nutzen, aber auch einen symbolischen: Die terrorisierten UkrainerInnen können so wieder Hoffnung schöpfen. Wie damals in Hamburg und Mostar.
Als Hans Koschnik, Ex-Bürgermeister in Bremen, nach dem Balkan-Krieg EU-Administrator in Mostar für Bosnien-Herzegowina war, war er verantwortlich für den Wideraufbau. Koschnik hatte am Ende des Kriegs in Hamburg gelebt, und erinnerte sich an die verglasten Straßenbahnen. Nun gibt es in Mostar keine Straßenbahn, aber eine im Krieg zerstörte Brücke über den Fluss Neretva, das Wahrzeichen der Stadt. Die Brücke verbindet den bosnischen mit dem herzegowinischen Stadtteil. Koschnik sorgte als erstes dafür, dass dieses Wahrzeichen rekonstruiert wurde, als Symbol für den Wiederaufbau und die Verbindung der beiden Volksteile. Übrigens Mostar heißt Brücke.
-----------------------

Ähnliche Überlegungen werden jetzt für die Ukraine angestellt. Bereits jetzt während der russischen Bombardements auf die ukrainische Infrastruktur, sollen möglichst viele zerstörte Straßen, Brücken, Kraft- und Wasserwerke, Bahnhöfe und Gleisanlagen funktionsfähig gemacht werden. Das hat praktischen Nutzen, aber auch einen symbolischen: Die terrorisierten UkrainerInnen können so wieder Hoffnung schöpfen. Wie damals in Hamburg und Mostar.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 24. September 2022
Unwissenheit über Israel und Palästina
jf.bremen, 13:06h
Das Thema Israel und die Palästinenser ploppt immer mal wieder hoch, zuletzt anlässlich der verschiedenen Auseinandersetzungen um vermeintlich oder tatsächlich antisemitische Exponate auf der dokumenta. Auch in Sachen Boykott von Waren aus den von Israel besetzten Palästinenser-Gebieten (BDS) wabern unterschiedliche Einschätzungen. Der Vorwurf, BDS sei antiisraelisch oder gar antisemitisch, trifft den Kern der Sache nicht. BDS richtet sich nicht gegen Israel als Ganzes, sondern nur gegen die israelische Besatzung im Westjordanland.
In der Debatte um die dokumenta kam u.a. die Behauptung auf, die israelische Armee habe während des Linanon-Kriegs 1982 das Massaker im Palästina-Flüchtlingslager von Sabra und Schatila (Libanon) verübt. Das ist in dieser verkürzten Form falsch und es darf nicht über die tatsächliche Beteiligung der israelischen Armee (IDF) hinweggetäuscht werden.
Die christliche Phalange-Miliz drang damals unter einem Vorwand mit Billigung der IDF in das Lager ein und richtete ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung an, dem tausende zum Opfer fielen. Die IDF hatte das Lager umstellt und die Eingänge blockiert, in Anwesenheit des israelischen Verteidigungsministers Ariel Scharon und des Generalstabschefs Rafael Eitan. Die IDF lieferte zudem logistische Unterstützung (Planierraupen) und Verpflegung.
Die Generalversammlung der UNO und die israelische Kahan-Kommission wiesen der Armee eine Mitverantwortung zu. Das führte in Israel dazu, dass Eitan als Generalstabschef und Scharon als Verteidigungsminister zurücktreten mussten. Scharons politische Karriere war damit nicht beendet, er blieb Minister ohne Geschäftsbereich und schaffte es später bis zum Außenminister. 2000 provozierte er die zweite Intifada: er betrat in Begleitung von 1000 Polizisten, Militärs, Journalisten und Politikern den Tempelberg, der vor allem Moslems, aber auch Christen und Juden heilig ist. Der daraus resultierende Eklat motivierte eine konservative Mehrheit, ihn im Jahr darauf zum Ministerpräsidenten zu wählen.
In der Debatte um die dokumenta kam u.a. die Behauptung auf, die israelische Armee habe während des Linanon-Kriegs 1982 das Massaker im Palästina-Flüchtlingslager von Sabra und Schatila (Libanon) verübt. Das ist in dieser verkürzten Form falsch und es darf nicht über die tatsächliche Beteiligung der israelischen Armee (IDF) hinweggetäuscht werden.
Die christliche Phalange-Miliz drang damals unter einem Vorwand mit Billigung der IDF in das Lager ein und richtete ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung an, dem tausende zum Opfer fielen. Die IDF hatte das Lager umstellt und die Eingänge blockiert, in Anwesenheit des israelischen Verteidigungsministers Ariel Scharon und des Generalstabschefs Rafael Eitan. Die IDF lieferte zudem logistische Unterstützung (Planierraupen) und Verpflegung.
Die Generalversammlung der UNO und die israelische Kahan-Kommission wiesen der Armee eine Mitverantwortung zu. Das führte in Israel dazu, dass Eitan als Generalstabschef und Scharon als Verteidigungsminister zurücktreten mussten. Scharons politische Karriere war damit nicht beendet, er blieb Minister ohne Geschäftsbereich und schaffte es später bis zum Außenminister. 2000 provozierte er die zweite Intifada: er betrat in Begleitung von 1000 Polizisten, Militärs, Journalisten und Politikern den Tempelberg, der vor allem Moslems, aber auch Christen und Juden heilig ist. Der daraus resultierende Eklat motivierte eine konservative Mehrheit, ihn im Jahr darauf zum Ministerpräsidenten zu wählen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 12. August 2022
Geschichte ist nicht Gegenwart
jf.bremen, 16:59h
Neulich waren wir zu Besuch in Berlin und bei einer jungen Freundin und ihrer Familie eingeladen. Sie leben in einer großen, älteren Wohnanlage mit einem großen Innenhof. Herrlich ruhig mit viel Platz für Kinder und Große. Dort aßen wir an einer Tisch-Bank-Kombination zu Abend. Sie ist mit einem echten Berliner verheiratet, und sie haben zwei kleine Kinder. Alles also ganz "normal".
Zwischendurch tauchte eine kleine Gruppe Jugendlicher mit Rucksäcken auf. Als sie uns sahen, machten sie kehrt und trollten sich betont unauffällig. Unser Gastgeber klärte uns auf: Die Kiffer und Fixer kämen hier immer mal vorbei, um ungestört zu rauchen und zu drücken.
Für mich als ehemaligen Westberliner war der Stadtteil eher "unnormal". Friedrichshain, also Ost. Damals, vor 1989, hätte ich für den Besuch einen Perso und ein Besuchsvisum mit Begrenzung auf Mitternacht gebraucht. Jetzt wechselte ich ganz einfach mit dem Fahrrad von Kreuzberg nach Friedrichshain, inzwischen ein einziger Bezirk.
-----------------------------------
Zum Schluss unseres Besuchs schlug unsere Freundin vor, uns mit dem Fahrrad zu begleiten, auf einem andren Weg als wir gekommen waren. Wir gondelten auf Schleichwegen zur Frankfurter Allee, die unsere Freundin uns begeistert vorführte: Die breite Straße mit Grünstreifen in der Mitte, die Alleebäume links und rechts, die Geschäfte in Pavillons, alles pikobello.
Ich konnte ihre Begeisterung spontan nicht teilen. Für mich war es die Stalinallee, das hieß 17. Juni 1953, die Bauerarbeiter-Revolte gegen erhöhte Arbeitsnormen, die russischen Panzer, die den Aufstand niederwalzten, die Schikanen der VoPos an der Grenze, wenn man in den Osten der Stadt wollte. All das klebte für mich an den Kacheln der Häuser, die seinerzeit schon kurz nach dem Bau von den Wänden fielen.
Ich weiß nicht, ob unsere Freundin meine Reserviertheit verstanden hat, gesagt hat sie nichts, ich aber auch nicht. Später wurde mir klar: sie lebt in einer anderen Generation, die das alles viel unbefangener sieht. Die ehemalige Teilung ist Geschichte, spielt im Alltag keine Rolle. Ihr Mann arbeitet im Westen der Stadt, was nicht heißt in Westberlin. Sie hat vorher in Neukölln gewohnt und in Friedrichshain gearbeitet. Alles ganz normal. Nur mir macht meine Erinnerung noch immer Probleme. Zeit sich davon zu emanzipieren. Sie hat dafür das Startzeichen gegeben. Dank dafür.
Zwischendurch tauchte eine kleine Gruppe Jugendlicher mit Rucksäcken auf. Als sie uns sahen, machten sie kehrt und trollten sich betont unauffällig. Unser Gastgeber klärte uns auf: Die Kiffer und Fixer kämen hier immer mal vorbei, um ungestört zu rauchen und zu drücken.
Für mich als ehemaligen Westberliner war der Stadtteil eher "unnormal". Friedrichshain, also Ost. Damals, vor 1989, hätte ich für den Besuch einen Perso und ein Besuchsvisum mit Begrenzung auf Mitternacht gebraucht. Jetzt wechselte ich ganz einfach mit dem Fahrrad von Kreuzberg nach Friedrichshain, inzwischen ein einziger Bezirk.
-----------------------------------

Zum Schluss unseres Besuchs schlug unsere Freundin vor, uns mit dem Fahrrad zu begleiten, auf einem andren Weg als wir gekommen waren. Wir gondelten auf Schleichwegen zur Frankfurter Allee, die unsere Freundin uns begeistert vorführte: Die breite Straße mit Grünstreifen in der Mitte, die Alleebäume links und rechts, die Geschäfte in Pavillons, alles pikobello.
Ich konnte ihre Begeisterung spontan nicht teilen. Für mich war es die Stalinallee, das hieß 17. Juni 1953, die Bauerarbeiter-Revolte gegen erhöhte Arbeitsnormen, die russischen Panzer, die den Aufstand niederwalzten, die Schikanen der VoPos an der Grenze, wenn man in den Osten der Stadt wollte. All das klebte für mich an den Kacheln der Häuser, die seinerzeit schon kurz nach dem Bau von den Wänden fielen.
Ich weiß nicht, ob unsere Freundin meine Reserviertheit verstanden hat, gesagt hat sie nichts, ich aber auch nicht. Später wurde mir klar: sie lebt in einer anderen Generation, die das alles viel unbefangener sieht. Die ehemalige Teilung ist Geschichte, spielt im Alltag keine Rolle. Ihr Mann arbeitet im Westen der Stadt, was nicht heißt in Westberlin. Sie hat vorher in Neukölln gewohnt und in Friedrichshain gearbeitet. Alles ganz normal. Nur mir macht meine Erinnerung noch immer Probleme. Zeit sich davon zu emanzipieren. Sie hat dafür das Startzeichen gegeben. Dank dafür.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 29. Mai 2022
"Es war einmal vor langer, langer Zeit ....,"
jf.bremen, 15:47h
da verlor Deutschland einen Krieg. Große Landstriche und viele Städte wurden verwüstet. Menschen starben zu Millionen, wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Fremde Mächte eroberten das Land und befreiten es von einem grausamen Herrscher und seinen Schergen. Viele Menschen jedoch, die vor der Grausamkeit des Herrschers geflohen waren, sich verborgen hatten oder durch das Leid geläutert worden waren, schworen, das Land besser und schöner wieder aufzubauen.
Einige fanden einen schönen Ort ganz oben im Norden, an dem sie mit dem Neuaufbau beginnen wollten. Sie sammelten Gleichgesinnte um sich, bekamen von den fremden Mächten einen bescheidenen Schatz und öffneten die Türen ihrer Hütte für junge Menschen, denen sie von der finsteren Vergangenheit erzählten und mit denen sie gemeinsam berieten, wie das Land der Zukunft aussehen sollte. Sie nannten diese Hütte den "Jugendhof Steinkimmen". Hand- und Mundwerksburschen arbeiteten gemeinsam in der Hütte.
Mit viel Mühe näherten sie sich im Laufe der Zeit ihren Zielen. Immer mehr junge Leute kamen dorthin, begeisterten sich für diese Ziele und trugen die Botschaft ins ganze Land. Die Hütte wurde größer, schöner und komfortabler. Das ging viele Jahrzehnte sehr gut. Nach vierzig Jahren feierten alle zusammen ein großes Fest und freuten sich über das Erreichte. Nach wieder zehn Jahren feierten sie noch ein Fest, das war noch schöner und größer. Aber am Horizont zogen dunkle Wolken auf, aus denen kurz darauf heftige Blitze zuckten und Donner grollte. Es kamen Sendboten der Regierung, die die Quelle verstopften, aus denen die Menschen frisches Wasser schöpften, und vertrieben die Bewohner des Anwesens."
-----------------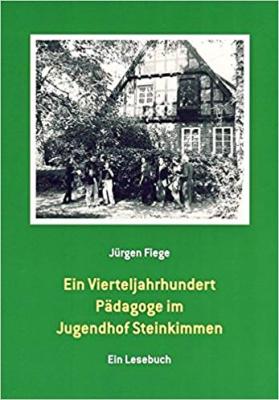
Soweit das Märchen. Aber es ist gar kein Märchen, sondern die Geschichte einer außerschulischen Bildungsstätte, die Generationen von Jugendlichen und Erwachsenen Anregungen vermittelte, für politisches Bewusstsein und eine besseres und schöneres Leben arbeitete.
So das Vorwort für das Buch "Ein Vierteljahrhundert Pädagoge im Jugendhof Steinkimmen - Ein Lesebuch" von Jürgen Fiege (Oldenburg 2014, ISBN 978-3-7308-1091-0) Das Buch ist weiterhin lieferbar, entweder über den Buchhandel oder direkt beim Autor zum Preis von 10,00 Euro zzgl. Versand: jürgen.fiege@nord-com.net
Einige fanden einen schönen Ort ganz oben im Norden, an dem sie mit dem Neuaufbau beginnen wollten. Sie sammelten Gleichgesinnte um sich, bekamen von den fremden Mächten einen bescheidenen Schatz und öffneten die Türen ihrer Hütte für junge Menschen, denen sie von der finsteren Vergangenheit erzählten und mit denen sie gemeinsam berieten, wie das Land der Zukunft aussehen sollte. Sie nannten diese Hütte den "Jugendhof Steinkimmen". Hand- und Mundwerksburschen arbeiteten gemeinsam in der Hütte.
Mit viel Mühe näherten sie sich im Laufe der Zeit ihren Zielen. Immer mehr junge Leute kamen dorthin, begeisterten sich für diese Ziele und trugen die Botschaft ins ganze Land. Die Hütte wurde größer, schöner und komfortabler. Das ging viele Jahrzehnte sehr gut. Nach vierzig Jahren feierten alle zusammen ein großes Fest und freuten sich über das Erreichte. Nach wieder zehn Jahren feierten sie noch ein Fest, das war noch schöner und größer. Aber am Horizont zogen dunkle Wolken auf, aus denen kurz darauf heftige Blitze zuckten und Donner grollte. Es kamen Sendboten der Regierung, die die Quelle verstopften, aus denen die Menschen frisches Wasser schöpften, und vertrieben die Bewohner des Anwesens."
-----------------
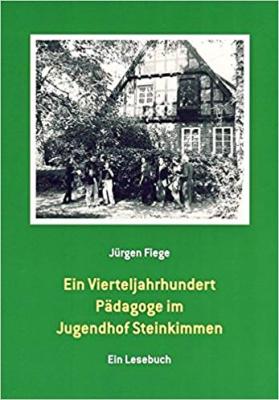
Soweit das Märchen. Aber es ist gar kein Märchen, sondern die Geschichte einer außerschulischen Bildungsstätte, die Generationen von Jugendlichen und Erwachsenen Anregungen vermittelte, für politisches Bewusstsein und eine besseres und schöneres Leben arbeitete.
So das Vorwort für das Buch "Ein Vierteljahrhundert Pädagoge im Jugendhof Steinkimmen - Ein Lesebuch" von Jürgen Fiege (Oldenburg 2014, ISBN 978-3-7308-1091-0) Das Buch ist weiterhin lieferbar, entweder über den Buchhandel oder direkt beim Autor zum Preis von 10,00 Euro zzgl. Versand: jürgen.fiege@nord-com.net
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 30. April 2022
Wer im Glashaus sitzt ...
jf.bremen, 21:24h
Söder weiß mal wieder Bescheid: Er fordert Altbundeskanzler Schröder auf, angesichts seiner Sympathien für den Autokraten Putin und dessen Politik, aus der SPD auszutreten. Nicht ganz verkehrt, aber unangemessen aus dem Mund des CSU-Vorsitzenden.
Mal so gefragt: Wann erkennt die CSU ihrem Ehrenvorsitzenden Franz-Josef Strauß diesen Ehrentitel ab? Strauß pflegte nicht nur enge Beziehungen zum chilenischen Diktator Pinochet und zum Apartheid-Staat Südafrika wie zu vielen anderen obskuren afrikanischen Regenten, er lobte das Pinochet-Regime dafür, "für Ordnung gesorgt" zu haben, eine Ordnung, die 3.000 Todesopfer, politische Gefangene, Emigranten und Folteropfer brachte. Da könnte man durchaus auf die Idee kommen, den Ehrenvorsitz abzuerkennen, was Söder aber wohl nicht vorhat.
Lindner, FDP-Vorsitzender, schlug in die gleiche Kerbe. Da könnte man mal fragen, wie sein Verhältnis zum Ex-Vorsitzenden Erich Mende aussieht, der reihenweise Nazi-Orden sammelte und sich noch in den 50er Jahren mit dem Ritterkreuz am Hals in der Öffentlichkeit zeigte. Wann hat die Partei sich je von DEM distanziert?
Genau! Wird auch mal Zeit, bevor anderen Parteivorsitzenden irgendwelche Ratschläge erteilt werden.
Mal so gefragt: Wann erkennt die CSU ihrem Ehrenvorsitzenden Franz-Josef Strauß diesen Ehrentitel ab? Strauß pflegte nicht nur enge Beziehungen zum chilenischen Diktator Pinochet und zum Apartheid-Staat Südafrika wie zu vielen anderen obskuren afrikanischen Regenten, er lobte das Pinochet-Regime dafür, "für Ordnung gesorgt" zu haben, eine Ordnung, die 3.000 Todesopfer, politische Gefangene, Emigranten und Folteropfer brachte. Da könnte man durchaus auf die Idee kommen, den Ehrenvorsitz abzuerkennen, was Söder aber wohl nicht vorhat.
Lindner, FDP-Vorsitzender, schlug in die gleiche Kerbe. Da könnte man mal fragen, wie sein Verhältnis zum Ex-Vorsitzenden Erich Mende aussieht, der reihenweise Nazi-Orden sammelte und sich noch in den 50er Jahren mit dem Ritterkreuz am Hals in der Öffentlichkeit zeigte. Wann hat die Partei sich je von DEM distanziert?
Genau! Wird auch mal Zeit, bevor anderen Parteivorsitzenden irgendwelche Ratschläge erteilt werden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 16. März 2022
Bundeswehr - bedingt abwehrbereit
jf.bremen, 12:44h
Die Wehrbeauftragte des Bundestags stimmt in das Klagelied über die unzureichende Ausrüstung der Bundeswehr ein. Angestimmt hat es der Generalinspekteur des Heers, der die Truppe für "blank" hält. Den Oberton übernahm der Bundeskanzler: 100 Milliarden Euro sollen die Misere beheben.
Diesem Lied kann ich eine historische Note hinzufügen. Als seit 1956 die Bundeswehr aufgebaut wurde, griff das Verteidigungsministerium zunächst auf alte Bestände der USA und der britischen Armee zurück: z.B. die Panzer (Centurion, M 42 und M 48). Dann ging man dazu über, vor allem Fahrzeuge aus deutscher Produktion anzuschaffen. Dabei galt die Parole: Jeder marode und von Pleite bedrohte deutsche Hersteller wird saniert. Das galt u.a. für die Borgward-Kleinlastwagen, den DKW-Jeep, das Zündapp-Motorrad - alle technisch unzuverlässig und teilweise unzweckmäßig.
Der Höhepunkt der Sorglosigkeit war unser Schützenpanzer HS 30. Der Hersteller Hispano-Swizza hatte vorher nie einen Panzer gebaut. Die Entscheidung für den Auftrag wurde von Verteidigungsminister F.J. Strauß und Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Vorstellung eines Holzmodells in Tischgröße getroffen.
.....
Das Militär hatte einen Schützenpanzer mit hoher Feuerkraft, Schnelligkeit, guter Panzerung und flacher Form gefordert. Der Panzer sollte 9 Tonnen wiegen; als er fertig war, wog er 14 Tonnen. Als Komponenten wurde gewählt: eine 20-mm-Flugzeug-Kanone, die im Gelände regelmäßig versagte; ein Motor, der für einen anderen Zweck konzipiert war, zwei alternative Getriebe, die wegen des zu großen Panzer-Gewichts ständig versagten. Für die Stoßdämpfer galt dasselbe; die Kette war mit Gummipolstern versehen, damit der Panzer auch auf Straßen fahren konnte; diese Polster flogen bei höherer Geschwindigkeit nach hinten weg. Normal bestand eine Kompanie aus 16 Panzern. Bei einem mehrtägigen Manöver rückte unsere Kompanie mit acht Panzern aus und war damit die stärkste des Bataillons. Nach drei Tagen hatten wir noch zwei Panzer - ohne Feindeinwirkung.
Das führte zu der grotesken Situation, dass die Besatzungen der ausgefallenen Panzer auf die restlichen sowie auf Unimog-Attrappen verteilt werden mussten. Hätten wir "Feindberührung" gehabt, hätten wir uns gegenseitig in der Schusslinie gehockt.
Um dem chronischen Mangel an Panzern zu begegnen, hatte man als "Übungspanzer" Unimog-Fahrzeuge mit einer Blechattrappe in Form eines HS 30 versehen. Der Höhepunkt war eine Geländeausbildung. Da kein Panzer zur Verfügung stand, mussten wir uns so aufstellen, wie wir auf dem Panzer saßen. Und dann wurden Manöver "gefahren": Panzer marsch (wir liefen in dieser Formation vorwärts), Panzer halt (wir blieben stehen), Feuer frei (wir machten Päng-Päng), Panzer rückwärts Marsch (wir bewegten uns rückwärts), Stellungswechsel (wir liefen schräg nach rechts), und so weiter. So was kann ich mir nicht ausdenken, das habe ich 1964 erlebt!
Diesem Lied kann ich eine historische Note hinzufügen. Als seit 1956 die Bundeswehr aufgebaut wurde, griff das Verteidigungsministerium zunächst auf alte Bestände der USA und der britischen Armee zurück: z.B. die Panzer (Centurion, M 42 und M 48). Dann ging man dazu über, vor allem Fahrzeuge aus deutscher Produktion anzuschaffen. Dabei galt die Parole: Jeder marode und von Pleite bedrohte deutsche Hersteller wird saniert. Das galt u.a. für die Borgward-Kleinlastwagen, den DKW-Jeep, das Zündapp-Motorrad - alle technisch unzuverlässig und teilweise unzweckmäßig.
Der Höhepunkt der Sorglosigkeit war unser Schützenpanzer HS 30. Der Hersteller Hispano-Swizza hatte vorher nie einen Panzer gebaut. Die Entscheidung für den Auftrag wurde von Verteidigungsminister F.J. Strauß und Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Vorstellung eines Holzmodells in Tischgröße getroffen.
.....

Das Militär hatte einen Schützenpanzer mit hoher Feuerkraft, Schnelligkeit, guter Panzerung und flacher Form gefordert. Der Panzer sollte 9 Tonnen wiegen; als er fertig war, wog er 14 Tonnen. Als Komponenten wurde gewählt: eine 20-mm-Flugzeug-Kanone, die im Gelände regelmäßig versagte; ein Motor, der für einen anderen Zweck konzipiert war, zwei alternative Getriebe, die wegen des zu großen Panzer-Gewichts ständig versagten. Für die Stoßdämpfer galt dasselbe; die Kette war mit Gummipolstern versehen, damit der Panzer auch auf Straßen fahren konnte; diese Polster flogen bei höherer Geschwindigkeit nach hinten weg. Normal bestand eine Kompanie aus 16 Panzern. Bei einem mehrtägigen Manöver rückte unsere Kompanie mit acht Panzern aus und war damit die stärkste des Bataillons. Nach drei Tagen hatten wir noch zwei Panzer - ohne Feindeinwirkung.
Das führte zu der grotesken Situation, dass die Besatzungen der ausgefallenen Panzer auf die restlichen sowie auf Unimog-Attrappen verteilt werden mussten. Hätten wir "Feindberührung" gehabt, hätten wir uns gegenseitig in der Schusslinie gehockt.
Um dem chronischen Mangel an Panzern zu begegnen, hatte man als "Übungspanzer" Unimog-Fahrzeuge mit einer Blechattrappe in Form eines HS 30 versehen. Der Höhepunkt war eine Geländeausbildung. Da kein Panzer zur Verfügung stand, mussten wir uns so aufstellen, wie wir auf dem Panzer saßen. Und dann wurden Manöver "gefahren": Panzer marsch (wir liefen in dieser Formation vorwärts), Panzer halt (wir blieben stehen), Feuer frei (wir machten Päng-Päng), Panzer rückwärts Marsch (wir bewegten uns rückwärts), Stellungswechsel (wir liefen schräg nach rechts), und so weiter. So was kann ich mir nicht ausdenken, das habe ich 1964 erlebt!
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 15. Februar 2022
Prophezeiungen der Geheimdienste
jf.bremen, 19:55h
2003, die USA unter Präsident Bush, Invasion im Irak, ohne UN-Mandat, auch ohne Deutschland, vorbereitet durch eine Rede des US-Außenministers Powell vor dem Weltsicherheitsrat: Diktator Saddam Hussein habe große Menge von "Massenvernichtungsmitteln" gehortet und sei eine Bedrohung für den Weltfrieden. Das hätten die US-Sicherheitsdienste gemeldet. Scheint nicht unmöglich: Irak hatte im Krieg gegen Iran und im Kampf gegen Kurden Giftgas eingesetzt.
...................................
Also los: Invasion, Tötung Husseins, Besetzung, Zerstörung großer Teile des Landes. Seitdem Chaos im Land. Dann kommt der Knall: Nur Spuren von Giftgas werden gefunden, Powell bereut seine Rede im Weltsicherheitsrat, es seien Falschmeldungen gewesen. Aber Bush hat seinen "Grund" für die Invasion und sichert damit seine Wiederwahl. Der Zugriff auf irakisches Öl ist sicher gestellt.
Zeitsprung: 2022, 16. Februar, für diesen Tag haben US-Geheimdienste eine Invasion der Russen in der Ukraine prophezeit. Sollen wir jetzt hämisch lachen oder lieber das Schlimmste befürchten? Am 15. fliegt Bundeskanzler Scholz nach Moskau, der russische Präsident Putin erklärt, er setze auf Diplomatie und es würden gerade Truppen von der Grenze zur Ukraine abgezogen.
...................................

Also los: Invasion, Tötung Husseins, Besetzung, Zerstörung großer Teile des Landes. Seitdem Chaos im Land. Dann kommt der Knall: Nur Spuren von Giftgas werden gefunden, Powell bereut seine Rede im Weltsicherheitsrat, es seien Falschmeldungen gewesen. Aber Bush hat seinen "Grund" für die Invasion und sichert damit seine Wiederwahl. Der Zugriff auf irakisches Öl ist sicher gestellt.
Zeitsprung: 2022, 16. Februar, für diesen Tag haben US-Geheimdienste eine Invasion der Russen in der Ukraine prophezeit. Sollen wir jetzt hämisch lachen oder lieber das Schlimmste befürchten? Am 15. fliegt Bundeskanzler Scholz nach Moskau, der russische Präsident Putin erklärt, er setze auf Diplomatie und es würden gerade Truppen von der Grenze zur Ukraine abgezogen.
... link (1 Kommentar) ... comment
Samstag, 5. Februar 2022
"Sprottenkiste" und "Keine der stärksten der Parteien - 1968"
jf.bremen, 15:27h
Zwei Bücher bei AG-SPAK von Jürgen Fiege:
Aus der Verlagsankündigung
Aus der Tiefe der Zeit steigen Erinnerungen an die alte Zeit - die nie nur gut war - und aktuelle Reflektionen der Verhältnisse auf. Kieler Sprotten sind diese kleinen goldgelb geräucherten Heringe. "Kieler Sprotten" wurden aber auch in Kiel geborene Kinder genannt.
--------------------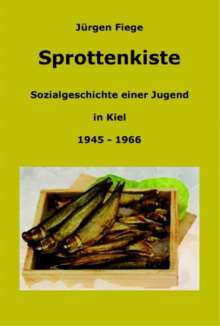
Jürgen Fiege - eine "Kieler Sprotte" - schreibt über Erlebnisse und deren Interpretation. Dieses Buch lädt zum Blättern und Schmökern ein. Die Kapitel folgen keinem chronologischen System, sie sind thematisch geordnet. Die Texte gelten auch für andere Orte. Jüngere Leser können sozialgeschichtliche Kenntnisse über die damalige Zeit gewinnen, älteren Lesern ist es eine Anregung, das eigene Leben zu reflektieren.
Die Texte verallgemeinern über den engen lokalen Bezug hinaus. Sie sind auch für Nicht-Kieler interessant und lesenswert. Der Autor lebte - mit Unterbrechungen - von 1942 bis 1966 in Kiel, durchlief Schule, Universität und Bundeswehr, machte in unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen und untersucht diese auf ihre sozialen und politischen Implikationen. Aus diesen Erfahrungen entstand sein Engagement in der Studentenbewegung, sowie in den sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre.
Die Kapitel beschreiben Orte und Ereignisse, gehen aber über das Deskriptive hinaus und betonen soziale, psychologische und politische Aspekte. Individuelle Erlebnisse werden verallgemeinert, so dass das Typische in Zeit und Ort durchscheint.
Der Leser, die Leserin werden zurück in die "Tiefe der Zeit" zwischen 1947 und 1966 geführt. Sie sind eingeladen zur Entdeckungsreise in eine turbulente Zeit, auch wenn sie auf den ersten Blick totlangweilig erscheint.
"SPROTTENKISTE " Sozialgeschichte einer Jugend in Kiel", Neu-Ulm 2018, 14,50 € zzgl. Versand, ISBN 978-3-945959-35-0
-------------------
Der Autor, Jahrgang 1942, studierte von 1966 - 1970 Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin, einem der Brennpunkte der Studentenrevolte. Neben dem Studium, der Arbeit am Theater und in der Jugendbildung engagierte er sich für universitäre und gesellschaftspolitische Themen.
Der Autor war keiner der "Promis" der 68er, er zählte eher zum "Fußvolk der Bewegung". In studentischen Gremien, dem Studentendorf Schlachtensee und der "Kritischen Universität" war er ebenso aktiv wie auf Demonstrationen, Sit-Ins und Teach-Ins.
Der zentrale Ansatz dieses Buch liegt darin, dass für Jürgen Fiege "1968" weder der Beginn noch das Ende der Revolte war. Die Ursachen des Aufstands liegen in den gesellschaftspolitischen Bedingungen der Bundesrepublik weit früher in den 1950er Jahren, und die Wirkungen machen sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis in die Gegenwart bemerkbar. Der Autor entwickelt das entlang seiner Biografie. Er zeigt in unterschiedlichen Bereichen die Bedingungen für die Unzufriedenheit der jungen Generation und wie sie ihre Wirkung seitdem entfalten.
Den Wehrdienst leistete er wie viele seiner Altersgenossen. Im Unterschied zu anderen beschreibt er diese Zeit als prägend für seine spätere Entwicklung und sein politisches und gesellschaftliches Engagement.
Der Einfluss der Studentenbewegung zeigt sich auch in scheinbar "unpolitischen" Themen wie "Hochzeiten", "Bewerbungen", "Tod und Sterben". Jürgen Fiege nimmt die Parole "Alles ist politisch" in seinen Texten ernst und macht das Politische im Alltäglichen genauso sichtbar wie in den großen Ereignissen.
Anekdoten und scheinbar nebensächliche Erlebnisse lockern die Lektüre auf und machen sie unterhaltsam.
"KEINE DER STÄRKSTEN DER PARTEIN " Erlebnisse eines ganz normalen 68ers", 14,50 € zzgl. Versand, Neu-Ulm 2018, ISBN 978-3-945959-36-7
Aus der Verlagsankündigung
Aus der Tiefe der Zeit steigen Erinnerungen an die alte Zeit - die nie nur gut war - und aktuelle Reflektionen der Verhältnisse auf. Kieler Sprotten sind diese kleinen goldgelb geräucherten Heringe. "Kieler Sprotten" wurden aber auch in Kiel geborene Kinder genannt.
--------------------
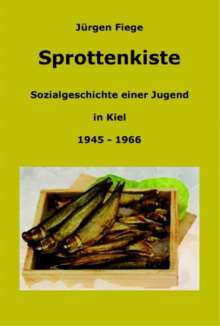
Jürgen Fiege - eine "Kieler Sprotte" - schreibt über Erlebnisse und deren Interpretation. Dieses Buch lädt zum Blättern und Schmökern ein. Die Kapitel folgen keinem chronologischen System, sie sind thematisch geordnet. Die Texte gelten auch für andere Orte. Jüngere Leser können sozialgeschichtliche Kenntnisse über die damalige Zeit gewinnen, älteren Lesern ist es eine Anregung, das eigene Leben zu reflektieren.
Die Texte verallgemeinern über den engen lokalen Bezug hinaus. Sie sind auch für Nicht-Kieler interessant und lesenswert. Der Autor lebte - mit Unterbrechungen - von 1942 bis 1966 in Kiel, durchlief Schule, Universität und Bundeswehr, machte in unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen und untersucht diese auf ihre sozialen und politischen Implikationen. Aus diesen Erfahrungen entstand sein Engagement in der Studentenbewegung, sowie in den sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre.
Die Kapitel beschreiben Orte und Ereignisse, gehen aber über das Deskriptive hinaus und betonen soziale, psychologische und politische Aspekte. Individuelle Erlebnisse werden verallgemeinert, so dass das Typische in Zeit und Ort durchscheint.
Der Leser, die Leserin werden zurück in die "Tiefe der Zeit" zwischen 1947 und 1966 geführt. Sie sind eingeladen zur Entdeckungsreise in eine turbulente Zeit, auch wenn sie auf den ersten Blick totlangweilig erscheint.
"SPROTTENKISTE " Sozialgeschichte einer Jugend in Kiel", Neu-Ulm 2018, 14,50 € zzgl. Versand, ISBN 978-3-945959-35-0
-------------------

Der Autor, Jahrgang 1942, studierte von 1966 - 1970 Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin, einem der Brennpunkte der Studentenrevolte. Neben dem Studium, der Arbeit am Theater und in der Jugendbildung engagierte er sich für universitäre und gesellschaftspolitische Themen.
Der Autor war keiner der "Promis" der 68er, er zählte eher zum "Fußvolk der Bewegung". In studentischen Gremien, dem Studentendorf Schlachtensee und der "Kritischen Universität" war er ebenso aktiv wie auf Demonstrationen, Sit-Ins und Teach-Ins.
Der zentrale Ansatz dieses Buch liegt darin, dass für Jürgen Fiege "1968" weder der Beginn noch das Ende der Revolte war. Die Ursachen des Aufstands liegen in den gesellschaftspolitischen Bedingungen der Bundesrepublik weit früher in den 1950er Jahren, und die Wirkungen machen sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis in die Gegenwart bemerkbar. Der Autor entwickelt das entlang seiner Biografie. Er zeigt in unterschiedlichen Bereichen die Bedingungen für die Unzufriedenheit der jungen Generation und wie sie ihre Wirkung seitdem entfalten.
Den Wehrdienst leistete er wie viele seiner Altersgenossen. Im Unterschied zu anderen beschreibt er diese Zeit als prägend für seine spätere Entwicklung und sein politisches und gesellschaftliches Engagement.
Der Einfluss der Studentenbewegung zeigt sich auch in scheinbar "unpolitischen" Themen wie "Hochzeiten", "Bewerbungen", "Tod und Sterben". Jürgen Fiege nimmt die Parole "Alles ist politisch" in seinen Texten ernst und macht das Politische im Alltäglichen genauso sichtbar wie in den großen Ereignissen.
Anekdoten und scheinbar nebensächliche Erlebnisse lockern die Lektüre auf und machen sie unterhaltsam.
"KEINE DER STÄRKSTEN DER PARTEIN " Erlebnisse eines ganz normalen 68ers", 14,50 € zzgl. Versand, Neu-Ulm 2018, ISBN 978-3-945959-36-7
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 4. November 2021
Nach 40 Jahren Glasfaser - Hurra!
jf.bremen, 16:44h
1982 verhinderte der korrupte Bundes-Minister für Telekommunikation Schwartz-Schilling (CDU) die Verkabelung mit Glasfaser. An dem damals schon veralteten Kupferkabeln verdiente seine Frau privat, deren Firma "Sonnenschein" Kupferkabel herstellte. Die Glasfasertechnik war bereits damals die Technik der Zukunft. Schwartz-Schillings Entscheidung für Kupferkabel stieß bei Medienleuten im In- und Ausland auf heftige Kritik und Unverständnis.
40 (in Worten: vierzig) Jahre später titelt der Weserkurier vom 4.11.21: "Glasfaser kommt nach Findorff." Und damit kein Übermut aufkommt, lautet der Untertitel: "Ausbau beginnt im kommenden Jahr." Das hätten die Findorffer und alle anderen Bundesbürger schon früher haben können, wenn Rückständigkeit und Korruption nicht zur DNA der Kohl-Regierung gehört hätte.
40 (in Worten: vierzig) Jahre später titelt der Weserkurier vom 4.11.21: "Glasfaser kommt nach Findorff." Und damit kein Übermut aufkommt, lautet der Untertitel: "Ausbau beginnt im kommenden Jahr." Das hätten die Findorffer und alle anderen Bundesbürger schon früher haben können, wenn Rückständigkeit und Korruption nicht zur DNA der Kohl-Regierung gehört hätte.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite