Donnerstag, 10. September 2020
Corona-Tagebuch 70.:„Ich habe gehört…“ – „Alternative“ Informationsbeschaffung
jf.bremen, 20:10h
Chaire, cheure, cheire nipton
Eine Frau aus meinem Bekanntenkreis erklärte mir bei verschiedenen Gelegenheiten:
• Ins Kino gehe sie nicht mehr, sie bediene sich bei Netflix.
• Fernsehen gucke sie nicht mehr, das Internet genüge.
• Eine Tageszeitung lese sie nicht, siehe oben.
• Für lokale Ereignisse selbst in ihrem Stadtteil interessiere sie sich nicht.
• Mir fiel gelegentlich auf, dass sie Gespräche begann mit „Ich habe gehört….“ Ohne weitere Quellenangabe.
Anfangs dachte ich: Na, vielleicht geht’s so auch. Meine Informationsbeschaffung muss ja nicht vorbildlich sein: Tagesschau, Tagesthemen, Magazin-Sendungen, zwei Tageszeitungen, Rundfunk. Aber Informationsbeschaffung nur im Internet? Zu oft trifft der kritische Zeitgenosse auf obskure Quellen. Das ist doch etwas einseitig, aber man kann da ja auch Zeitung lesen. Tut sie aber nicht.
-----------------------------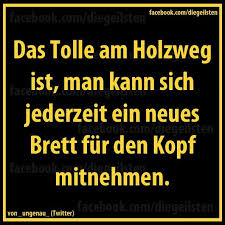
Ehrlich geschockt war ich, als sie sich in einer Diskussion als Corona-Leugnerin entpuppte. Der offiziellen Politik, dem RKI, den Medizinern und Wissenschaftlern und „den Medien“ inklusive taz glaube sie nicht. Im Internet – wieder ohne Quellenangabe – finde sie ganz andere Informationen. Stutzig wurde sie erst, als eine Medizinerin in dem Kreis ruhig und bestimmt ihre Fakten ausbreitete. Na, immerhin, dann ist ja noch nicht alles verloren.
Was mich am meisten schockierte: Bisher hielt ich die Frau für sympathisch und ernst zu nehmen. Tröstlich ist die Tatsache, dass laut diverser Meinungsumfragen weniger als 10% der Bevölkerung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sind. Neulich die 40.000 in Berlin - das war'n fast schon alle! Und wer hat die Gegendemonstranten gezählt?
Bleibt aufrecht und gesund.
Eine Frau aus meinem Bekanntenkreis erklärte mir bei verschiedenen Gelegenheiten:
• Ins Kino gehe sie nicht mehr, sie bediene sich bei Netflix.
• Fernsehen gucke sie nicht mehr, das Internet genüge.
• Eine Tageszeitung lese sie nicht, siehe oben.
• Für lokale Ereignisse selbst in ihrem Stadtteil interessiere sie sich nicht.
• Mir fiel gelegentlich auf, dass sie Gespräche begann mit „Ich habe gehört….“ Ohne weitere Quellenangabe.
Anfangs dachte ich: Na, vielleicht geht’s so auch. Meine Informationsbeschaffung muss ja nicht vorbildlich sein: Tagesschau, Tagesthemen, Magazin-Sendungen, zwei Tageszeitungen, Rundfunk. Aber Informationsbeschaffung nur im Internet? Zu oft trifft der kritische Zeitgenosse auf obskure Quellen. Das ist doch etwas einseitig, aber man kann da ja auch Zeitung lesen. Tut sie aber nicht.
-----------------------------
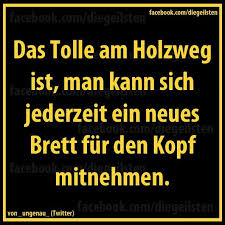
Ehrlich geschockt war ich, als sie sich in einer Diskussion als Corona-Leugnerin entpuppte. Der offiziellen Politik, dem RKI, den Medizinern und Wissenschaftlern und „den Medien“ inklusive taz glaube sie nicht. Im Internet – wieder ohne Quellenangabe – finde sie ganz andere Informationen. Stutzig wurde sie erst, als eine Medizinerin in dem Kreis ruhig und bestimmt ihre Fakten ausbreitete. Na, immerhin, dann ist ja noch nicht alles verloren.
Was mich am meisten schockierte: Bisher hielt ich die Frau für sympathisch und ernst zu nehmen. Tröstlich ist die Tatsache, dass laut diverser Meinungsumfragen weniger als 10% der Bevölkerung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sind. Neulich die 40.000 in Berlin - das war'n fast schon alle! Und wer hat die Gegendemonstranten gezählt?
Bleibt aufrecht und gesund.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 24. August 2020
Täter „soll“ gemordet haben
jf.bremen, 15:47h
In Christchurch, Neuseeland, beginnt in dieser Woche der Prozess gegen den Attentäter, der im März 2019 in dieser Stadt zwei Moscheen stürmte, einundfünfzig Betende erschießt und weitere schwer verletzt. Die Taten wurden von ihm selbst live ins Internet übertragen. Es gibt hunderte von Augenzeugen.
Das ist alles evident und beweisbar. Und dennoch wird im Rundfunk gesagt, er „solle“ das alles getan haben. Wieso der Konjunktiv, wieso soll? Damit soll einer Vorverurteilung vorgebeugt werden. So wie auch in anderen vergleichbar evidenten Fällen immer von „mutmaßlichen“ Tätern und mutmaßlichen Untaten gesprochen. Klar: solange nicht ein Gericht alles festgestellt hat, gilt die „Unschuldsvermutung“. Aber wieso Unschuld? Schuldig ist der Mann auch ohne Gerichtsurteil. Anders ist das, wenn Tat und Täter weniger offensichtlich sind. Aber in diesem Fall ist das völlig anders. Der Mann ist schuldig und jeder konnte es sehen!
Das ist alles evident und beweisbar. Und dennoch wird im Rundfunk gesagt, er „solle“ das alles getan haben. Wieso der Konjunktiv, wieso soll? Damit soll einer Vorverurteilung vorgebeugt werden. So wie auch in anderen vergleichbar evidenten Fällen immer von „mutmaßlichen“ Tätern und mutmaßlichen Untaten gesprochen. Klar: solange nicht ein Gericht alles festgestellt hat, gilt die „Unschuldsvermutung“. Aber wieso Unschuld? Schuldig ist der Mann auch ohne Gerichtsurteil. Anders ist das, wenn Tat und Täter weniger offensichtlich sind. Aber in diesem Fall ist das völlig anders. Der Mann ist schuldig und jeder konnte es sehen!
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 13. August 2020
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!
jf.bremen, 17:12h
Bundes-Senioren-Ministerin Giffey macht sich Sorgen um Senioren, die den Anschluss ans digitale Zeitalter angeblich verpasst haben.
Mal wieder muss eine Regierung die Versäumnisse und Sünden der Vergangenheit ausbaden. So wie der Ausbau der Glasfasernetze jetzt statt vor vierzig Jahren erfolgen muss, sollen diejenigen, die vor ebenfalls vierzig Jahres es versäumt haben, die damalig Jungen ans Internet heranzuführen.
Der seinerzeitige Minister für Post und Telekommunikation im Kabinett Kohl, Schwartz-Schilling (CDU), setzte 1982 durch, dass das Telefonwesen privatisiert und mit der veralteten Kupfer-Technik statt mit Glasfaser ausgestattet wurde, was Medienfachleute heftig kritisierten. Glasfaser war damals die Technik der Zukunft. Schwartz-Schillings Frau war Geschäftsführerin einer Kupferkabel-Fabrik. Fortschritt sieht anders aus!
Fortschrittliche Medienfachleute forderten nachdrücklich, Schulen, Volkshochschulen und andere Bildungsstätten mit digitaler Technik und Know-How auszustatten, um nicht nur Jugendliche auf die digitale Zukunft vorzubereiten. In Niedersachsen z.B. wurden einer außerschulischen Bildungsstätte für Jugendliche und MultiplikatorInnen 80.000 DM verwehrt, die für die Einrichtung eines Computer-Labors vorgesehen waren.
Und jetzt muss – spät, wenn nicht viel zu spät – viel Geld aufgewandt werden, um die so entstandenen Lücken auszufüllen.
Mal wieder muss eine Regierung die Versäumnisse und Sünden der Vergangenheit ausbaden. So wie der Ausbau der Glasfasernetze jetzt statt vor vierzig Jahren erfolgen muss, sollen diejenigen, die vor ebenfalls vierzig Jahres es versäumt haben, die damalig Jungen ans Internet heranzuführen.
Der seinerzeitige Minister für Post und Telekommunikation im Kabinett Kohl, Schwartz-Schilling (CDU), setzte 1982 durch, dass das Telefonwesen privatisiert und mit der veralteten Kupfer-Technik statt mit Glasfaser ausgestattet wurde, was Medienfachleute heftig kritisierten. Glasfaser war damals die Technik der Zukunft. Schwartz-Schillings Frau war Geschäftsführerin einer Kupferkabel-Fabrik. Fortschritt sieht anders aus!
Fortschrittliche Medienfachleute forderten nachdrücklich, Schulen, Volkshochschulen und andere Bildungsstätten mit digitaler Technik und Know-How auszustatten, um nicht nur Jugendliche auf die digitale Zukunft vorzubereiten. In Niedersachsen z.B. wurden einer außerschulischen Bildungsstätte für Jugendliche und MultiplikatorInnen 80.000 DM verwehrt, die für die Einrichtung eines Computer-Labors vorgesehen waren.
Und jetzt muss – spät, wenn nicht viel zu spät – viel Geld aufgewandt werden, um die so entstandenen Lücken auszufüllen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 25. Februar 2020
Faschmeldung: "Fremdenhass"
jf.bremen, 16:05h
Der Weser-Kurier vom 22.02.20 titelt "Mahnwachen gegen Fremdenhass".
Zehn Personen wurden in Hanau erschossen, von einem Täter mit rechtsextremen Motiven. Festzuhalten ist, dass alle zehn Deutsche waren. Es ist völlig unangemessen, in diesem Fall von Fremdenhass zu reden. Das Motiv ist Menschenhass!
Selbst wenn die Personen, die die Mahnwache organisierten, von Fremdenhass als Motiv ausgegangen sind, hätte der Begriff wenigstens in Anführungsstrichen gesetzt werden müssen. Wann verstehen Politiker, die Medien und ihre Macher, dass Deutschland seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Einwanderungsland ist und dass alle Menschen, die hier leben und die deutsche Staatsbürgerschaft haben, Deutsche und keine Fremden sind? Auch wenn sie keinen deutsch klingenden Namen haben.
Zehn Personen wurden in Hanau erschossen, von einem Täter mit rechtsextremen Motiven. Festzuhalten ist, dass alle zehn Deutsche waren. Es ist völlig unangemessen, in diesem Fall von Fremdenhass zu reden. Das Motiv ist Menschenhass!
Selbst wenn die Personen, die die Mahnwache organisierten, von Fremdenhass als Motiv ausgegangen sind, hätte der Begriff wenigstens in Anführungsstrichen gesetzt werden müssen. Wann verstehen Politiker, die Medien und ihre Macher, dass Deutschland seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Einwanderungsland ist und dass alle Menschen, die hier leben und die deutsche Staatsbürgerschaft haben, Deutsche und keine Fremden sind? Auch wenn sie keinen deutsch klingenden Namen haben.
... link (1 Kommentar) ... comment
Montag, 20. Januar 2020
Die 68er und ihr Hofstaat
jf.bremen, 13:10h
Neulich in Bremen im Cinema: Susanne Schunte-Kleemann spricht in Ergänzung zu einem Film über die Rolle von Frauen in der 68er Bewegung. Der Focus der Veranstaltung auf die Frauenthematik war in der Lage, das tendenziöse Bild der 68er-Frauen als kaffeekochende Tippsen gerade zu rücken. Das war auch höchste Zeit!
Susanne Schunte-Kleemann illustrierte den Vortrag mit Fotos aus ihrem Privatarchiv und Medien. Darunter immer wieder Bilder von Veranstaltungen im Audimax der Freien Universität Berlin. Sie benennt die Namen von prominenten Frauen (auch Männern), die links, rechts, vor und hinter dem Rednerpult sitzen. Die „Sitzordnung“ ergab sich aus dem Umstand, dass bestimmte Veranstaltungen so gut besucht waren, dass wir – ich war auch oft dabei – auf Fensterbänken, am Boden und eben auf dem Podium sitzen oder stehen mussten.
Die Bilder zeigen das, was auch auf den Fotos von Michael Ruetz zu sehen war. Und schon beim Erscheinen seines Fotobandes war mir das aufgefallen, was ich aus eigener Erinnerung wusste. Die „führenden Leute“ vom SDS waren immer schon da, bevor das Audimax sich füllte. Und sie besetzten zunächst das Podium.
Das stellte sicher, was heute noch evident ist, dass sie auf allen Fotos zu sehen waren, die den oder die Vortragende(n) zeigten. Sie umlagerten das Podium wie ein Hofstaat. Wir, das „gemein Fußvolk“ der Studentenbewegung, hockten im Anonymen.
Das erinnert mich an ein Erlebnis vor einigen Jahren in Cuxhaven: Ich eröffnete eine Ausstellung „100 Jahre Film in Niedersachsen“. Der Veranstalter stellte mich vor, und ich wollte gerade mit meinem Vortrag beginn, da entstand hinter mir ein Getümmel. Irritiert drehte ich mich um: Da drängelten sich mehrere Schlipsmänner um mich und das Rednerpult. Aus dem Augenwinkel registrierte ich einen Pressefotografen. Es war Kommunalwahlkampf und jeder der Schlipsmänner wollte mit mir möglichst wirkungsvoll aufs Bild.
Schließlich: Bei der Abstimmung im Bundestag über Organspende verharrte die Fernsehkamera einen Augenblick auf der „Gewinnerin“ Annalena Baerbock, links flankiert von der anderen grünen Prominenten Claudia Roth. Rechts saß die ganz neue Bremer Abgeordnete Kappert-Gonther. In anderem Zusammenhang nennt man das Product-Placement.
Susanne Schunte-Kleemann illustrierte den Vortrag mit Fotos aus ihrem Privatarchiv und Medien. Darunter immer wieder Bilder von Veranstaltungen im Audimax der Freien Universität Berlin. Sie benennt die Namen von prominenten Frauen (auch Männern), die links, rechts, vor und hinter dem Rednerpult sitzen. Die „Sitzordnung“ ergab sich aus dem Umstand, dass bestimmte Veranstaltungen so gut besucht waren, dass wir – ich war auch oft dabei – auf Fensterbänken, am Boden und eben auf dem Podium sitzen oder stehen mussten.
Die Bilder zeigen das, was auch auf den Fotos von Michael Ruetz zu sehen war. Und schon beim Erscheinen seines Fotobandes war mir das aufgefallen, was ich aus eigener Erinnerung wusste. Die „führenden Leute“ vom SDS waren immer schon da, bevor das Audimax sich füllte. Und sie besetzten zunächst das Podium.
Das stellte sicher, was heute noch evident ist, dass sie auf allen Fotos zu sehen waren, die den oder die Vortragende(n) zeigten. Sie umlagerten das Podium wie ein Hofstaat. Wir, das „gemein Fußvolk“ der Studentenbewegung, hockten im Anonymen.
Das erinnert mich an ein Erlebnis vor einigen Jahren in Cuxhaven: Ich eröffnete eine Ausstellung „100 Jahre Film in Niedersachsen“. Der Veranstalter stellte mich vor, und ich wollte gerade mit meinem Vortrag beginn, da entstand hinter mir ein Getümmel. Irritiert drehte ich mich um: Da drängelten sich mehrere Schlipsmänner um mich und das Rednerpult. Aus dem Augenwinkel registrierte ich einen Pressefotografen. Es war Kommunalwahlkampf und jeder der Schlipsmänner wollte mit mir möglichst wirkungsvoll aufs Bild.
Schließlich: Bei der Abstimmung im Bundestag über Organspende verharrte die Fernsehkamera einen Augenblick auf der „Gewinnerin“ Annalena Baerbock, links flankiert von der anderen grünen Prominenten Claudia Roth. Rechts saß die ganz neue Bremer Abgeordnete Kappert-Gonther. In anderem Zusammenhang nennt man das Product-Placement.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 29. Dezember 2019
Analoge Schwarz-Weiß-Fotografie
jf.bremen, 15:53h
„Natürlich muss das Negativ erst mal was hergeben. Doch dann geht es darum, einen Himmel etwas aufzuhellen, einem Schatten mehr sattes Schwarz zu geben. Oft muss man lange nachbelichten, um Figuren im Hintergrund, wo es dünn wird, plastischer herauszuarbeiten. Diese Beschäftigung mit dem unfertigen Bild ist für mich unersetzlich. Wir hatten in der Zeitung auch Laboranten, aber wenn es drauf ankam, habe ich die Vergrößerungen und die Abzüge immer selbst gemacht. Auch für alle meine Ausstellungen."
Könnten Sie das mit Photoshop nicht viel leichter haben?
"Leichter vielleicht. Nur mit einer anderen Qualität. Für mich hat ein Analogbild noch immer mehr Tiefe und atmosphärische Nuancen. Digitale Fotos sind kälter. In gewisser Weise perfekter. Da ich immer schwarz-weiß fotografiere, ergibt sich mit der Silbergelatine beim Abzug auf Fotopapier eine mehr malerische Tönung."
Fotografin Barbara Klemm im Interview mit dem „Tagesspiegel“ 15.12.2019

Foto: jf. - 82
Könnten Sie das mit Photoshop nicht viel leichter haben?
"Leichter vielleicht. Nur mit einer anderen Qualität. Für mich hat ein Analogbild noch immer mehr Tiefe und atmosphärische Nuancen. Digitale Fotos sind kälter. In gewisser Weise perfekter. Da ich immer schwarz-weiß fotografiere, ergibt sich mit der Silbergelatine beim Abzug auf Fotopapier eine mehr malerische Tönung."
Fotografin Barbara Klemm im Interview mit dem „Tagesspiegel“ 15.12.2019

Foto: jf. - 82
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 23. November 2019
Politisch korrekte Sprache IV
jf.bremen, 15:23h
Wie soll man denn nun die Nachbarn mit dunkler Hautfarbe, einem türkischen Pass (oder haben sie gleichzeitig oder ausschließlich einen deutschen?) und türkischer Sprache bezeichnen? Ausländer – nee; Migranten oder Einwanderer – auch wenn sie in der 3. Generation hier leben? Afrikanische MIT-BürgerInnen, wenn sie vor zwei Wochen hier hergekommen sind?
Und wie steht’s mit „Neger“? Neger ist die eingedeutschte Form von französisch nègre und das heißt schwarz. So what? Alles andere sind Krücken: Afrikaner – wenn derjenige in Deutschland als Kind eines farbigen Amerikaners geboren ist? Schwarzer – der aus Äthiopien stammt und eher braun ist (Brauner kann man auch nicht sagen!).
Es wäre also gut, Benutzer solcher Worte oder Redensarten nicht einfach so als Rassist o.ä. zu beschimpfen. Gucken wir erstmal danach was der/diejenige in genau diesem Zusammenhang meint und was er sonst so denkt und macht.
Und wie steht’s mit „Neger“? Neger ist die eingedeutschte Form von französisch nègre und das heißt schwarz. So what? Alles andere sind Krücken: Afrikaner – wenn derjenige in Deutschland als Kind eines farbigen Amerikaners geboren ist? Schwarzer – der aus Äthiopien stammt und eher braun ist (Brauner kann man auch nicht sagen!).
Es wäre also gut, Benutzer solcher Worte oder Redensarten nicht einfach so als Rassist o.ä. zu beschimpfen. Gucken wir erstmal danach was der/diejenige in genau diesem Zusammenhang meint und was er sonst so denkt und macht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 22. November 2019
Politisch korrekte Sprache III
jf.bremen, 22:23h
Manche Begriffe wandeln ihre Bedeutung: Z.B. „geil“ wurde im Mittelhochdeutschen noch für fröhlich im religiösen Sinn benutzt („mine sele was gail“), dann säkularisiert und schließlich banalisiert im sexuellen Sinn. In meiner Jugend hätte man sich nicht getraut, den Begriff überhaupt zu benutzen. Ausnahme: Gärtner sprachen von „geilen Trieben“. Damit waren lange dünne Zweige von Büschen gemeint, die die übrige Pflanze deutlich überragten. Bis vor etwa 20 Jahren benutzten Jugendliche den Begriff als Provokation; heute steht er nur noch für „gut“.
Früher wurden Behinderte bei körperlicher Behinderung „Krüppel“ (von „gekrümmt“) und bei geistiger oder psychischer Behinderung „Verrückte“ genannt (übrigens auch ein sehr ausdrucksstarker Begriff, wenn man den eigentlichen Sinn „ver-rückt“ bedenkt). Das wurde dann als diskriminierend aufgefasst und man wählte “Behinderte“. Behinderte selber wehrten sich inzwischen teilweise auch dagegen, weil auch dieses Wort inzwischen diskriminierend benutzt wird: „Du bist wohl behindert/Spasti oder was?“ Seit Neuestem spricht man nur noch von „Menschen mit Behinderungen“ oder Einschränkungen“. „Behinderte“ nämlich werden nur über ihre – eben – Behinderung oder Einschränkung definiert; sie gelten nicht als vollwertig.
Früher wurden Behinderte bei körperlicher Behinderung „Krüppel“ (von „gekrümmt“) und bei geistiger oder psychischer Behinderung „Verrückte“ genannt (übrigens auch ein sehr ausdrucksstarker Begriff, wenn man den eigentlichen Sinn „ver-rückt“ bedenkt). Das wurde dann als diskriminierend aufgefasst und man wählte “Behinderte“. Behinderte selber wehrten sich inzwischen teilweise auch dagegen, weil auch dieses Wort inzwischen diskriminierend benutzt wird: „Du bist wohl behindert/Spasti oder was?“ Seit Neuestem spricht man nur noch von „Menschen mit Behinderungen“ oder Einschränkungen“. „Behinderte“ nämlich werden nur über ihre – eben – Behinderung oder Einschränkung definiert; sie gelten nicht als vollwertig.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 21. November 2019
Politisch korrekte Sprache II
jf.bremen, 12:00h
Viele volkstümliche Begriffe oder Redewendungen sind Ergebnis genauer Beobachtung und sind nicht unbedingt diskriminierend gemeint. Z.B. „Nur keine jüdische Hast“ Wer einmal orthodoxe Juden in Wien, New York oder Jerusalem beobachtet hat, weiß, dass sie eine sehr hastige und nicht immer nachvollziehbare Eile zeigen, daher der Begriff, der keineswegs diskriminierend gemeint sein muss. Ähnlich der Ausdruck „Hier ist es laut wie in der Judenschule“ (=Synagoge, Gebetshaus/-stube). Juden beten (im Unterschied zu Christen) laut auch wenn sie allein beten, unterhalten sich während des Gottesdienst, verlassen den Raum und kommen wieder herein, früher wie heute. Da geht es schon mal etwas lauter zu.
Unbedacht wird Getto für ein Slum oder ein Lager benutzt. „Ghetto“ kommt aus dem Italienischen und bezeichnet Judenviertel oder –straße zuerst 1516 in Venedig und war keineswegs diskriminierend gemeint; die Juden wohnten einfach zusammen. Ähnlich in Deutschland, wo es früher Juden- oder Jüdenstraßen gab – z.B. noch heute in Göttingen.
Unbedacht wird Getto für ein Slum oder ein Lager benutzt. „Ghetto“ kommt aus dem Italienischen und bezeichnet Judenviertel oder –straße zuerst 1516 in Venedig und war keineswegs diskriminierend gemeint; die Juden wohnten einfach zusammen. Ähnlich in Deutschland, wo es früher Juden- oder Jüdenstraßen gab – z.B. noch heute in Göttingen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 20. November 2019
Politisch korrekte Sprache I
jf.bremen, 13:43h
„Political correctness“ in der Sprache verbietet dem fortschrittlichen Menschen bestimmte Worte. Dazu gehören „Zigeuner“, „Neger“, „Krüppel“, „Stamm“ u.a. Oft wird das ohne genaue Kenntnis über Sprache gemacht - ohne lange nachzudenken. Die Person des Sprechers oder die Situation sind dabei egal. Einmal den falschen Begriff benutzt und, zack, du bist ein Rassist.
Nur mal der Begriff „Zigeuner“: wird heute meist als diskriminierend aufgefasst, ist es aber ursprünglich gar nicht, denn er stammt aus der „Zigeuner“-Sprache und damit bezeichneten sich diese Leute selbst, denn es heißt eigentlich „Menschen“ und das schon seit 1417 in Europa (von „Secaner“). Die Begriffe „Cigan“ (auf dem Balkan), „Gitanos“ in Spanien und „Gitanes“ in Frankreich – wo selbst eine Zigarettenmarke so heißt - gehen auf dieselbe Wurzel zurück und werden dort ohne Probleme benutzt. Erst die Zigeuner-Feinde (vor allem die Nazis) haben behauptet, Zigeuner käme von „Ziehgauner“ = (Taschen-) Dieb.
Nur mal der Begriff „Zigeuner“: wird heute meist als diskriminierend aufgefasst, ist es aber ursprünglich gar nicht, denn er stammt aus der „Zigeuner“-Sprache und damit bezeichneten sich diese Leute selbst, denn es heißt eigentlich „Menschen“ und das schon seit 1417 in Europa (von „Secaner“). Die Begriffe „Cigan“ (auf dem Balkan), „Gitanos“ in Spanien und „Gitanes“ in Frankreich – wo selbst eine Zigarettenmarke so heißt - gehen auf dieselbe Wurzel zurück und werden dort ohne Probleme benutzt. Erst die Zigeuner-Feinde (vor allem die Nazis) haben behauptet, Zigeuner käme von „Ziehgauner“ = (Taschen-) Dieb.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite